|
Kapitel 4: Die Zeugnisse und die Zeugen
Unterkapitel 4 e: Ratzeburg
und Anschließendes
Der
Ratzeburger Dom 1) wird mit Recht als
die Krone der romanischen Ziegelbauten gerühmt (Abb. 45). Zugleich
wird er, zumal nach seiner gegenwärtigen zurechtgeschobenen
Erscheinung und wegen der am Gewölbe auffallend sich bemerkbar
machenden Spitzbogen 2) 3) als ein Werk
des Übergangsstils betrachtet. Die Zeit seiner Vollendung wird sich
nicht feststellen lassen; aber begonnen ist der Bau, nach der alles
Zutrauen verdienenden Inschrifttafel, am 11. des Augusts 1154.
Heinrich der Löwe hat ihn gegründet.
1) Bau- und Kunstdenkmäler in der
Provinz Schleswig-Holstein. 1886 bis 1890 und 1924 und 1925. 6
Bände. Zitiert als: "BD ...". - BD. 6, 79, 15. 19
2) BD. 6, 62, 4.
3) Haupt, Richard: Die Vizelinskirchen.
Kiel 1884. Neue Ausgabe Plön, 1888, S. 81 ff.
98
99
Er kann nicht ganz mit demselben Rechte wie die anderen guten Zeugen
unserer Reihe die Stelle als fünfter behaupten. Denn er ist
kein legitimer Sprößling der in Wagrien erwachsenen, zu Lübeck
ausgebildeten Kunst. Die geschichtlichen Umstände, unter denen er
erwachsen ist, geben volle Klarheit.
Er ist angelegt an einer Stelle, die Heinrich, Graf von Ratzeburg,
auf der Insel im See dafür anzuweisen hatte. Der Herzog hat es als
eigene Aufgabe betrieben, die Erbauung, Förderung und Ausstattung
zum Abschluß zu bringen.
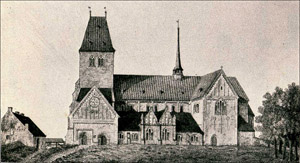
45 Der Dom zu
Ratzeburg, nach einer Lithographie der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Links: Oberteil des Bischofshofes. Seitdem (1880 u. 1893) geändert:
der Turm (Dach und Gesimse), der Dachreiter, neu, jetzt über der
Kreuzung. Verschwunden das niedere got. Seitenschiff, das got.
Fenster am Querhause, das kleinere Portal an der Vorhalle.
Mausklick ins Bild vergrößert die Darstellung!
Der Grundplan (s. Abb. 46) ist, nur um ein Joch kürzer, der gleiche,
nach dem der Herzog auch den Dom zu Lübeck und, nach seiner Heimkehr
1173, seine Hofkirche St. Blasii zu Braunschweig hat erbauen lassen.
Die Ausführung zu Lübeck konnte er mit Vertrauen seinem Freunde dem
Bischof Gerold in die Hände geben, und in der großen aufstrebenben
Stadt hat der Überfluß an Kräften nicht gefehlt. Zu Ratzeburg nichts
dergleichen. Arbeiter mochten aus Wagrien aufgeboten werden;
vielleicht war das nötig, da der Plan, auf Haustein zielend, nur mit
den Mitteln der jungen Ziegelbaukunst ausgeführt werden konnte. Doch
nahm man zum Mauern nicht den Segeberger
99
100
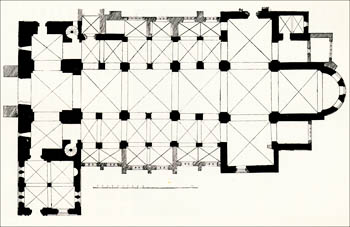
46 Der Dom zu
Ratzeburg 1:400. Aus einem Risse des 19. Jahrhunderts. Die äußeren
Seitenschiffe sind 1880 entfernt, auch sonst einiges geändert, drei
Portale vermauert
100
101
Gips, sondern beschaffte sich den gewohnten Kalk. Über den Ziegelbau
wußte der erste Bischof Evermod genügend Bescheid. Er hat selbst
1154 den Erbauer der Kirche von Neumünster, des gewaltigen
Backsteinbaus, dort begraben, und der allgeschäftige Volchart lebte
damals noch. So haben die nächsten Mittel des wagrischen Ziegelbaus
zur Verfügung gestanden, und es ward nach dessen bewährter Art ver-

47 Inneres des Domes gegen Osten gesehen
fahren:
mit der Herstellung der trefflichen Ziegel in den festen Maßen, dem
bestimmten Verbande ohne Füllwerk, den Friesen von Kreuzbogen und
Rauten, und strenger Einhaltung der Scharrierung. Doch in dieser
zeigt sich ein neuer Geist, etwas Angelerntes, Ängstliches,
Manieriertes andeutend. Man konnte sie leichter als mit Hammer und
Meißel mit dem Messer, oder Spachtel, am noch nassen Batzen
101
102
ausführen und das Messer hat auch sonst an den Stücken seine Dienste
getan. Und in einer Menge von einzelnen Zügen drängen sich nun
fremde Elemente herein. Diese sind zugleich Zeichen der Tätigkeit
eines lebhaften, nach Mannigfaltigkeit strebenden Geistes. Dieser
war von den wagrischen Kunstformen in nichts abhängig. Wohl aber
zeigen sich in allen Abweichungen die Einwirkungen der hoch
entwickelten sächsischen Baukunst vom Harze. Natürlich ist nicht das
Ganze zugleich fertig gemacht worden. Am ältesten ist, wie mehrfach,
der östliche Teil, Chor mit Apsis und Querhaus. Dann folgte aber die
Aufführung des Westteiles, des Turmbaus, für den Quer- oder

48 Beide westlichste Arkadenbogen der
südlichen Reihe, der eine spitzbogig
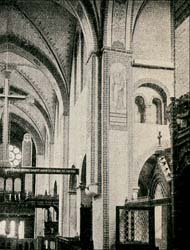
49 Nordwestliche Ecke der Vierung.
Eines der beiden Doppelfenster;
in einem stehen 2, im andern
3 Säulen hinter einander
Doppelturm (der jedoch nicht hochgeführt worden ist; er erhielt
später einen Einzelturm über das Zwischenhaus). Endlich geschah im
Innern die Ausführung der noch fehlenden Doppeljoche des
eigentlichen Schiffes. Bei dieser zeigte es sich, daß man sich ein
wenig vermessen hatte, und einer der an den Turmbau anstoßenden
Arkadenbogen konnte nur in gespitztem Bogen ausgeführt werden (s.
Abb. 48). (Ähnlich war es zu Ringstedt, und in Sachsen selbst zu
Marienberg d. i. Helmstedt.) Der bewegliche Geist des Meisters zeigt
sich merkwürdig genug im Wechsel der Profile. So herrscht am
102
103
Ostteile außen und innen durchaus jener alte strenge sächsische
Viertelstab zwischen je zwo Kanten als RandprofiI (s. Abb. 42). Das
ist ebenso auch in dem nächsten Schiffsjoche, ja an der nördlichen
Wand noch etwas weiter. Im Turmteile dagegen ist die Profilierung
einfacher; da ist nur je eine Kante, die Gliederung der sog.
Kantonierung; zum Teile genügen hier auch rechteckige Kanten. In den
beiden mittleren Jochen des Schiffes aber wunderliche Lust der
Abwechselung. Die Zwischenpfeiler des östlicheren Joches zeigen das
Profil, das bei den Dänen eine besondere Bedeutung gewonnen hat,
nach dem sich vor die Kante, sie in sich bergend, ein Rundstab
gelegt hat, und dann folgt durchgehend das lübische, aus dem
sächsischen vereinfachte. Noch gibt es andere merkwürdig
selbständige Züge: an der
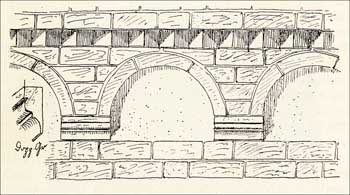
50 Bogenfries an der Apsis
Apsis einen abschließenden Fries aus breiten Rundbogen (Abb. 50),
und mehrfach aufsteigende Rundstäbe, statt Lisenen, obwohl sie sich
mit den Gesimsen schlecht vertragen. Solche sind besonders auch am
Stolze des Ganzen, der reich geschmückten Vorhalle (Abb. 45 f.), die
zugleich der jüngste Teil des Domes ist. Sie ist in ihrer Weise das
Vorbild, oder eher die Anregung des unvergleichlichen Paradieses am
Lübecker Dome. Jetzt als Kapelle erscheinend hat sie mitten die das
Gewölbe tragende gegliederte Stütze, die beiden Portale daher in der
Achse der beiden westlichen Kreuzgewölbe. Das zeigt sich etwas
störend darin, daß die innere Flucht der mächtig starken Turmwand
damit nicht harmoniert. Außer dem sehr reich gebildeten äußeren
Portale hatte die Südseite der Vorhalle noch ein zweites, fast
ebenso weites, die Offenheit der lichten Halle mit bedingendes. In
die Ostwand ist eine Apsisnische eingetieft, in der, wenigstens zu
103
104
Zeiten, ein Altar der hl. Jungfrau Platz fand. Die Giebelseite
geschmückt durch einen reichen Sockel, der auch, rechteckig darüber
gezogen, das Portal umfängt. Darüber ein reiches Quergesimse, und am
Giebel viele aufsteigende Rundstäbe, und etwelche Rosen, die Fläche
aber in Ährenverband ausgefüllt. An den verschiedenen Giebelschrägen
laufen die Kreuzbogenfriese schräg hinauf, statt gestaffelt
aufzusteigen. Letzeres findet sich auch am Dome zu Lübeck; in allem
übrigen ist dies alles der wagrischen Baukunst fremd. So selbst der
Ährenverand, bei dem wir uns erinnert sehen an das musivum
Studium, in dem sich bereits des hl. Bernwards Baulust zu
Hildesheim erging. Und die Einfassungen der Fenster der
Nebenschiffe, in Wagrien unverbrüchlich einfach geschrägt, sind hier
bereichert gewesen durch einen rechteckigen Einsprung. Namentlich
aber läuft in solchem Rücksprung meistens ber Umlaufstab um, der in
Portalen schon gebräuchlich war.
Kurz, wo sich Eigentümlichkeiten finden, weisen sie auf die Herkunft
vom Harze hin, und auf Verbindung damit. Und das ist ja ganz
natürlich. Der braunschweigische Herzog gab, wie für den Ausbau des
Lübecker Domes, eine jährliche Summe für den Ratzeburger, welcher
Anweisung 1173 bei der gleichen Gelegenheit gedacht wird. Der
Bischof Evermod ist 1178 gestorben. Er hatte schon, der
Überlieferung nach, den Leichnam des hl. Ansverus, Abtes zu
Ratzeburg, der 1066 gesteinigt war, in den Dom bringen und da
beisetzen lassen. Er selbst fand nun hier sein Grab. Und zwar war
sein Grab im südlichen Seitenschiffe, das demnach, obwohl ein so
untergeordneter Teil, schon geweihten Boden darbot. Von der
romanischen Ausstattung sind noch wenige, doch sehr bedeutsame Teile
übrig: die prachtvolle Kreuzgruppe (auf Abb. 47) und Stücke des
berühmten Chorgestühles. Wenn Heinrich der Löwe, nachdem er
Bardewiek samt den Kirchen zerstört hatte, 1189 unserem Dome alles
kostbare, darunter die Kelche und Bücher, und auch Glasfenster,
zugewiesen hat, so mag man es für wahrscheinlich halten, daß man
hier dafür Bedarf hatte; doch ist damit weiter nichts bewiesen.
Aber noch haben wir einen Blick auf das Gewölbe des Domes zu werfen
(s. Abb. 47). Es hat, mit seinen Spitzbogen, für die Datierung seine
besondere Rolle zu spielen gehabt und gibt Anhalt, das Alter des
Ganzen herabzudrücken. Daß hier, bei der Weite der Spannung, der
primitive Spitzbogen angewandt ist, ist nur zweckmäßig.
104
105
Hier ergibt sich für die Erkenntnis eine gewisse Schwierigkeit. Der
maßgebende Plan verlangte echte Kreuzgewölbe. Also für das ganze
eine durchlaufende Tonne, geschnitten von ebensolchen Kappen mit
geraden Scheiteln. Diese Anordnung ist auch befolgt, nur daß im
Turmbau (wie auch in der Vorhalle) die Kappen im Anschluß an die
Wände eine leichte Busung zeigen. Es herrscht aber eine
grundsätzliche Abweichung von der im Dome zu Lübeck befolgten
Gestaltung. Daselbst sind die starken Gewölbe keine eigentlichen
Kreuzgewölbe, sondern mehr kuppelförmig, durch kräftige rundbogige
Gurte von einander getrennt. Diese Gestaltung ist überhaupt für die
romanischen Backsteinbauten maßgebend, und das System ist hier zu
Ratzeburg für die Gewölbe der Nebenschiffe befolgt. Hier ist über
jedes der quadratischen
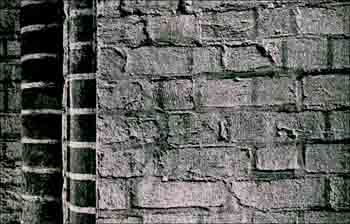
51 Eine Pfeilerkante
Joche eine recht flache Kappe gespannt. Im Obergadem ist das
Kreuzgewölbe maßgebend. Die Vierungsbogen teilen es in Quadrate.
Aber es sind auch im Langschiffe Gurte untergespannt, allerdings
ohne Verbindung mit dem eigentlichen Gewölbe. Bei diesem ist auf sie
nur in der Weise Rücksicht genommen, daß allemale da, wo darunter
der Gurtbogen ist, die Tonne unterbrochen erscheint und in einer
recht unordentlichen Weise aussetzt. Das Gewölbe ist einen Stein
stark, an den östlichsten, ältesten Teilen sogar noch etwas stärker,
was sich in eigentümlicher Weise durch die Art des Verbandes ergibt.
Es ist das alles unzweifelhaft dem romanischen Bau zuzurechnen. Daß
für das Gewölbe ein primitiver Spitzbogen zur Anwendung kam, war
zweckmäßig, und ist so auch zu Braunschweig.
105
106
Folgerichtig ist aber auch, daß die Vierungsbogen gespitzt sind;
rundbogig ist nur der Apsisbogen, wegen der halben Kuppel. Und so
sind denn auch die Gurte unbedenklich, und ganz entschieden,
spitzbogig. Diese Form hat einem Baumeister keinen Anstoß gegeben,
der sogar dem einen der Arkadenbogen den Spitzbogen zugeteilt hatte.
Daß es nun aber überall hier so gewaltsam in die Erscheinung tritt,
bestimmt den gesamten Eindruck im Innern so sehr, daß man meinen
kann, einen Bau des Übergangstils zu haben, trotz der
Entschiedenheit, in der sich im übrigen der romanische Charakter
hervortut (vgl. Abb. 49).
Es ist schwer denkbar, daß man hier zu einer Übereinstimmung der
Ansichten gelangen werde, obwohl der Charakter unserer besten Werke
des Übergangsstiles so weit von dem unseres Domes absticht. Das
Gewölbe hat nicht erst zu unserer Zeit Anstoß gegeben; man hat schon
eine allerdings ganz in der Luft hangende Überlieferung, nach der
der Dom ursprünglich eine platte Decke gehabt habe, das mittlere
Schiff nicht höher als die seitlichen. Das Gewölbe stamme erst vom
Ende des Mittelalters, und sei deshalb über die Maßen unordentlich
und schlecht 1). Wem es nun so passend
ist, der mag es der entarteten Gotik zuschreiben samt dem ganzen
Obergadem. Anderseits hat sich Dehio über den Braunschweiger Dom,
der ja nach dem Grundsatze das gleiche Gewölbe hat, und deshalb in
der Datierung herabgedrückt wird, folgendermaßen ausgesprochen:
„Braunschweig. Neubau durch Heinrich den Löwen 1173 bis 1195. Der
Hauptsache nach in Einem Zuge, das Triumphkreuz 1194 errichtet. In
der Kunstgeschichte Niedersachsens eine wichtige Epoche bezeichnend
als erster einheitlich durchgeführter Gewölbebau. Das Gewölbe zieht
aus dem gebundenen System die Folgen nur unvollständig. Es ist im
Hauptschiff eine Tonne. Leicht spitzbogige Brechung der Wandbogen,
geschichtlich bedeutsam als Beispiel für die Entstehung des
Spitzbogens ohne französisch-gotische Einwirkung."
Für den Übergangsstil ist dann das Ratzeburgische, und noch mehr das
Mecklenburgische, der rechte Tummelplatz. Die Überlieferungen des
romanischen Ziegelbaus (s. Abb. 52) werden schnell genug abgeworfen,
und nur wenige Bauwerke können ihn noch an sich bezeugen. Die
Scharrierung, unverstanden und höchstens eigensinnig von
1) Andere fanden es ausgezeichnet und
trefflich; so der kenntnisreiche Architekt Lauenburg, bei Masch,
Geschichte des Bistums Ratzeburg. Es ist fest und gut.
106
107
Altgewordenen festgehalten, verwahrloste, um ganz zu verschwinden,
und wo eine Bearbeitung für nötig erachtet ward, ward sie durch die
Messerung vertreten, die in die Gotik überging.
Wir haben gesehen, daß der Ratzeburger Dom zwar nach der Technik,
aber keineswegs nach der Kunstform ein Vertreter und Fortsetzer der
wagrischen Errungenschaft ist. Aber für das weitere dürfte gerade er
von Einfluß gewordn sein, indem das glanzvolle Beispiel Anregungen
gab. Und so finden wir im Übergangsstil Wagriens Formen, die dort
vorgebildet waren. Dem aus vier Halbsäulen zusammengebündelten
Pfeiler sind wir zuerst zu Segeberg begegnet, und dann finden wir
ihn zu Eutin. Aber auch zu Ratzeburg in der Vorhalle, und zwar hier
sogleich bereichert durch Dienste, die sich in die Winkel einfügen,
wie solche auch in den Fenstern, nicht bloß den Portalen, umlaufen.
Die Grundform, mit oder ohne die Dienste, ist dann für das noch fast
streng romanische Mölln maßgebend, und es folgt
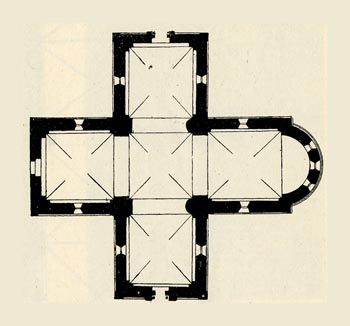
52 Kirche zu
Vietlübbe im Bistum Schwerin.
Eine der ganz wenigen in Mecklenburg,
die dem romanischen Stil zugesprochen
werden. Ursprung unbekannt.
Gadebusch, Schlagsdorf, Büchen, Breitenfelde, in Wagrien
Altenkrempe, zu Lübeck aber die jetzige Vorhalle des
Heiligengeisthauses, in der die Dienste bereits die Form geschärfter
Rundstäbe haben, wie sie sich vom Anfange des dreizehnten
Jahrhunderts an belegen lassen. Sie ist das bescheidene und schwer
mehr als solches erkennbare Überbleibsel eines mächtig angelegten
Kirchenbaus 1). Zu Altenkrempe ist die
Einfügung der Rundstäbe, zu starkem Unterschiede von Eutin,
maßgebend geworden. Auch die runde Lisene hat Aufnahme gefunden; sie
ist für uns in der Elbmarsch zu finden, namentlich aber ist sie von
den Dänen übernommen, wofür es auf Rügen die Beispiele gibt.
1) BD. 6, 24, 1, 37
Aus:
Richard Haupt: Kurze Geschichte des
Ziegelbaus und Geschichte
der deutschen Ziegelbaukunst bis durch das zwölfte Jahrhundert.
Heide; Heider Anzeiger, 1929. (Kapitel 4 e)
____________________________________________________
Hier die
Vorlage der Transkription des Titels sowie der Seiten 98-107, auch zum Download:

|
![]()