|
In: Vaterländische Blätter
[Altes und Neues aus Lübeck]
Unterhaltungsblatt der Lübekischen
Anzeigen, Jahrgang 1896, No. 14
Lübeck, den 20. December 1896.
Jakob von Falcke in Ratzeburg und Lübeck.
[Der Autor des Artikels schreibt stets
"Falcke" anstelle des korrekten "Falke".]
In den "Lebenserinnerungen von Jakob von Falcke", der, im Februar
1825 in kleinen Verhältnissen in Ratzeburg geboren, sich durch
eigene Kraft zu einer gewichtigen Stellung im kunstgewerblichen
Leben erst Nürnbergs und in der Folge der österreichischen
Reichshauptstadt - dort als Mitbegründer des Germanischen, hier als
Direktor des österreichischen Gewerbemuseums - emporrang[,]
so daß gefeierte und gekrönte Persönlichkeiten mit ihm gerne in
zwanglosen Verkehr sich unterhielten, finden sich sehr interessante[,]
auf Ratzeburg und Lübeck bezügliche Aufzeichnungen[,]
denen wir hier theilweise Raum geben wollen. Falcke erzählt, wie
keine Schule, keine bestehende Literatur[,]
sondern nur heiliger Eifer und frohe Lust zur Sache selbst den Kunst
Suchenden und nach Kunstsinne Begehrenden geleitet hat. Von seiner
Veranlagung nimmt er an, daß sie nach der künstlerischen Seite hin
nicht stark genug war, als daß er, selbst unter der Voraussetzung
einer entsprechenden Anleitung, es zum schaffenden Künstler von
Bedeutung hätte bringen können. Was ihm gegeben, war ein gutes
Gedächtniß, das ihn in die Lage versetzte, festzuhalten, was er
gesehen, es mit Anderem zu verbinden, zu vergleichen, aus der
Vergleichung Gedanken zu erwecken und Schlüsse zu ziehen. Dazu kam
eine reiche Empfänglichkeit des Gemüths, die alles seelisch
Anregende im Bereich von Kunst und Natur in sich aufzunehmen und mit
den durch das Gedächtnis festgehaltenen Eindrücken derart zu
verschmelzen verstand, daß sich daraus ein gesichertes
Kunstempfinden und -Wissen ergab.
"Mit solcher Anlage," so
fährt Jakob von Falcke, den wir in dem Folgenden selbst redend
einführen, fort, "ist es mir nach und nach gelungen, gewissermaßen
eine Sammlung von Bildern, von künstlerischen Erinnerungen im Geiste
anzulegen, und diese Sammlung, immer wachsend, immer sich
vermehrend, wird auch Interesse an der Kunst geschaffen und das
Interesse in Liebe und Verständniß verwandelt haben. Ich kann so
ziemlich das Wachsen und Werden, sozusagen meines geistigen Museums
verfolgen. Die
109 - Spalte links_
109 - Spalte rechts
Grundlage ist sehr alt und gehört schon
meiner frühesten Jugend an, ohne Zweifel zunächst meiner lieben
alten Domkirche, in welcher ich schon seit meinem zwölften oder
dreizehnten Jahre, da ich Chorschüler wurde, ganz zu Hause war. Ich
kannte das alte würdige Gebäude bis unter das Dach, bis in die
Spitze des Thurmes hinauf. Ich kannte seinen Bau und seine noch
zahlreich erhaltenen Alterthümer, wenn auch selbstverständlich noch
nicht als Kunstverständiger. Was wußte ich damals viel von Gothisch
und Romanisch - letzterer Ausdruck war ja noch nicht einmal erfunden
- aber ich sah die schweren Pfeiler, die Rundbogen, die bemalten
Wände darüber, die ornamentale Bemalung der Ecken und Kanten, das
Kreuzgewölbe, das hohe Mittelschiff und die niederen Seitenschiffe,
die Kapellenausbauten mit spitzbogigen Fenstern, den gewölbten
Kreuzgang mit seinen bizarren, mit Thierbildern geschmückten
Kapitälen, hohen, im Halbkreise gebauten Chor mit seinem Barockaltar
- ich sah alles, und es prägte sich dem jugendlichen Geiste
unauslöschbar ein.
Nur Eines habe ich nicht mehr gesehen, die
zwölf silbernen Apostel, welche die silberne Statuette Christi
umgaben und so in den Nischen einer Altartafel angebracht waren. Ich
sah nur noch diese Tafel mit ihren leeren Nischen an der Wand zur
Seite des Hochaltars hängen und konnte die Widmung lesen und den
Fluch, der für den Diebstahl ausgesprochen war. Es war in einer
Winternacht, als sie verschwanden. Ich mochte damals sechs bis
sieben Jahre sein und erinnere mich ganz deutlich, wie ich des
Morgens in aller Frühe mit der Nachricht geweckt wurde: "Die
silbernen Apostel sind gestohlen." Die Nachricht hatte sich schnell
verbreitet, denn die Figuren waren der Stolz von Ratzeburg, die
Stiftung eines Herrn von Bülow, irre ich nicht[,]
aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Sie waren fort, nur den
Christus hatte man im Schnee wieder aufgefunden, es scheint, er war
den Dieben zu schwer geworden, da er die doppelte Größe der Apostel
hatte. Die Spur der Diebe ging über den See, der zugefroren und mit
Schnee bedeckt war. Drüben verlor sie sich im Walde. Alle
Nachforschungen waren umsonst; vielleicht geschahen sie auch mit
wenig Geschick, denn etwa zehn Jahre später, da ich mit meinem Vater
in Lüneburg war, hörte ich dort von einem Zwiste zwischen zwei
Familien, welche sich gegenseitig des Diebstahls der Apostel
beschuldigten. Polizei oder Gericht erfuhren nichts davon. Der
Nachtwächter, welcher in jener Nacht den Dienst gehabt hatte - ich
kannte noch den alten Neding - erkränkte
[sic!] sich mehrere Jahre darauf im See. Es scheint[,]der
Fluch war an ihm in Erfüllung gegangen.
[Als der Artikel in den "Vaterstädtischen
Blättern" erschien, war das Buch noch nicht erschienen: die
Erstausgabe datiert aus dem Jahr 1897. Von Falke erweitert im Buch
die Wiedergabe seiner Erinnerungsfacetten an den Ratzeburger Dom im
fünften Kapitel "Wie ich zur Kunst kam".]
Hier die
Vorlage der Transkription, in Frakturschrift, auch zum Download:

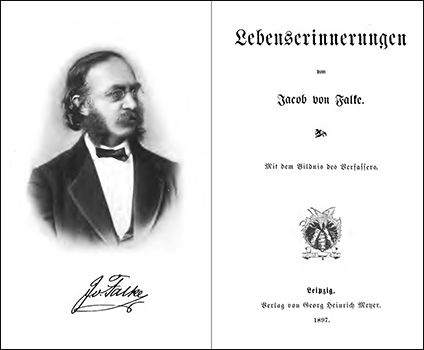
Vergrößerbare Abbildung durch Mausklick!
[...] Ich glaube nicht, daß ich ein
Künstler von Bedeutung geworden wäre. auch wenn ich so vom Glücke
begünstigt gewesen, um noch in früher Jugend Hand und Auge
auszubilden. Meine Phantasie, so viel ich davon besitze, ist nicht
erfindender, nicht schöpferischer Natur, sie ist aufnehmend
kombinierend, reproduzierend, [...]
098
099
Mit solcher
Anlage, so vermute ich, ist es mir nach and nach gelungen,
gewissermaßen eine Sammlung von Bildern, von künstlerischen
Erinnerungen im Geiste anzulegen, und diese Sammlung, immer
wachsend, immer sich vermehrend[,]
wird auch Interesse an der Kunst geschaffen und das Interesse in
Liebe und Verständnis verwandelt haben. Ich kann so ziemlich das
Wachsen und Werden, sozusagen meines geistigen Museums verfolgen.
Die Grundlage ist sehr alt und gehört schon meiner frühesten Jugend
an, ohne Zweifel zunächst meiner lieben alten Domkirche, in welcher
ich schon seit meinem zwölften oder dreizehnten Jahre, da ich
Chorschüler wurde, ganz zu Hause war. Ich kannte das alte würdige
Gebäude bis unter das Dach, bis in die Spitze des Turmes hinauf. Ich
kannte seinen Bau und seine noch zahlreich erhaltenen Altertümer,
wenn auch selbstverständlich noch nicht als Kunstverständiger.
Was wußte ich
damals viel von Gotisch und Romanisch - letzterer Ausdruck war ja
noch nicht einmal erfunden - aber ich sah die schweren Pfeiler, die
Rundbogen, die bemalten Wände darüber, die ornamentale Bemalung der
Ecken und Kanten, das Kreuzgewölbe, das hohe Mittelschiff und die
niederen Seitenschiffe, die Kapellenausbauten mit spitzbogigen
Fenstern, den gewölbten Kreuzgang mit seinen bizarren, mit
Tierbildern geschmückten Kapitälen, den hohen, im Halbkreise
099
100
gebauten Chor mit seinem Barockaltar - ich sah alles, und es prägte
sich dem jugendlichen Geiste unauslöschbar ein. Als ich später zur
theoretischen und historischen Kunstlehre kam, standen mir die
Beispiele lebendig in der Erinnerung.
Als Chorschüler hatte
ich die Verpflichtung, jedem Gottesdienste vom Anfange bis zum Ende
beizuwohnen, ja wir mußten früher anwesend sein, um z. B. die
Gesangsnummern in die Tafeln einzuschalten, und wir entfernten uns
auch erst, wenn niemand von der Gemeinde mehr anwesend war. Dabei
hatten wir denn auch oder nahmen uns das Recht, überall in der alten
Kirche umherzustöbern und gewissermaßen auf Entdeckungen auszugehen.
Bei solcher Gelegenheit sah ich auch in einem Seitenlokale die
verworfenen, mit Schnitzereien verzierten Teile der alten Chorsitze
romanischen Stils, die heute fast als die einzigen in ihrer Art und
in ihrem Alter zu einiger kunstgeschichtlichen Berühmtheit gelangt
sind. Ich sah sie gar oft, wußte aber sehr wenig ihren Wert zu
beurteilen. Ich sah den schönen Kronleuchter von Messing aus dem 16.
Jahrhundert, der über unserem Sängerstandplatze hing, das eiserne
Gitter-, welches den erhöhten Chor umgab, den gewaltigen
geschnitzten Christus über der kleinen Kanzel auf dem Lettner, ich
betrachtete oft und oft die große Tafel mit den Bildern aus dem
Leben des Ratzeburger Märtyrers, des heiligen Ansverus, welcher im
Jahre 1065 von den heidnischen Wenden erschlagen worden. Hinter dem
Altare fand ich noch in einem Schranke wohlerhaltene Meßgewänder von
geschnittenem Sammtstoffe, die etwa aus dem Anfange des 16.
Jahrhunderts stammten, also wohl die letzten, die noch im Dome zum
katholischen Gottesdienste, das will sagen bei der letzten Messe,
gebraucht worden sind, nebst einigen anderen, jener Zeit angehörigen
Gegenständen kirchlichen Gebrauchs. Ich stieg auch wohl in die
Krypte hinab, betrachtete
100
101
Särge und
Grabsteine, von welchen letzteren die meisten zwar, weil auf dem
Boden liegend, von den Füßen der Besucher abgetreten waren. Nur im
Kreuzgange, unmittelbar neben der Thür zur Quarta, befand sich,
aufrechtstehend und wohlerhalten, ein Stein, der einen Mönch und
eine Nonne im Relief darstellte. Sie sollten an dieser Stelle
eingemauert sein, so ging die Sage.
Nur Eines habe ich nicht mehr gesehen, die zwölf silbernen Apostel,
welche die silberne Statuette Christi umgaben und so in den Nischen
einer Altartafel angebracht waren. Ich sah nur noch diese Tafel mit
ihren leeren Nischen an der Wand zur Seite des Hochaltars hängen und
konnte die Widmung lesen und den Fluch, der für den Diebstahl
ausgesprochen war. Es war in einer Winternacht, als sie
verschwanden. Ich mochte damals sechs bis sieben Jahre alt sein und
erinnere mich ganz deutlich, wie ich des Morgens in aller Frühe mit
der Nachricht geweckt wurde: "Die silbernen Apostel sind gestohlen."
Die Nachricht hatte sich schnell verbreitet, denn die Figuren waren
der Stolz von Ratzeburg, die Stiftung eines Herrn von Bülow, irre
ich nicht[,] aus dem Anfange des
16. Jahrhunderts. Sie waren fort, nur den Christus hatte man im
Schnee wieder aufgefunden, es scheint, er war den Dieben zu schwer
geworden, da er die doppelte Größe der Apostel hatte. Die Spur der
Diebe ging über den See, der zugefroren und mit Schnee bedeckt war.
Drüben verlor sie sich im Walde. Alle Nachforschungen waren umsonst;
vielleicht geschahen sie auch mit wenig Geschick, denn etwa zehn
Jahre später, da ich mit meinem Vater in Lüneburg war, hörte ich
dort von einem Zwiste zwischen zwei Familien, welche sich
gegenseitig des Diebstahls der Apostel beschuldigten. Polizei oder
Gericht erfuhren nichts davon. Der Nachtwächter, welcher in jener
Nacht den Dienst gehabt
101
102
hatte - ich kannte
noch den alten Neding - ertränkte sich mehrere Jahre darauf im See.
Es scheint, der Fluch war an ihm in Erfüllung gegangen
Ein anderes
Kunstwerk, kein großes zwar - hat erst die Restaurationswut unserer
Tage verschwinden gemacht. Die Wände des Hauptschiffes waren in der
ganzen Flucht über den Bögen mit lebensgroßen Fresken, grau in grau,
aus der biblischen Geschichte bedeckt, Arbeiten der Barockzeit und,
wie gesagt, künstlerisch nicht von besonderer Leistung. Immerhin
waren sie ein Schmuck der breiten Wände und wie eine christliche
Bilderbibel fiir die Gemeinde. Bereits in protestantischer Zeit
entstanden, hätte man sie bestehen lassen können, moderner
protestantischer Eifer, gepaart mit der nüchternen Restaurationswut,
welche vor einigen Jahrzehnten einriß, hat sie mit weißer Tünche
überzogen. Jetzt genießt die Gemeinde den horror vacui,
den Anblick leerer Wände.
Auch sonst scheint
die Restauration gewütet zu haben. Vor nicht langer Zeit sah ich
einige Photographien aus dem Innern des Domes und bemerkte mit
Schrecken, wie Vieles darin geändert worden, selbst in der
originalen, aus alter oder ursprünglicher Zeit stammenden Anlage.
Ich war vierzig Jahre lang nicht in der Kirche gewesen und erkannte
doch, soweit es bei den Photographien möglich war, alle
Veränderungen, so fest steht der alte liebe Dom in meiner
Erinnerung, unvergeßlich wie ein Freund der Jugendzeit. In
allerjüngsten Tagen ist sogar der Blitz in ihn hineingefahren, und
der Brand hat Turm und Dach zerstört. Selbstverständlich müssen sie
wieder erbaut werden, aber es soll nicht geschehen - so höre ich
wenigstens - wie es war, alt, treu, schlicht und ehrwürdig, sondern
mit moderner Architektenweisheit.
102
103
Ohne Zweifel ist es
der Dom gewesen, der die erste Ahnung von Kunst und Altertum, wenn
auch unbewußt, in die Seele eingepflanzt hat: die Stadt Ratzeburg
bietet oder bot sonst gar nichts, keine Sammlungen, keinen
Privatbesitz von Kunstsachen irgend einer Art, kein Rathaus, das man
ansehen mag, keine Kirche weiter als das allernüchternste,
phantasieloseste Gebäude der "Stadtkirche", jeden Kunstgedankens,
jeden Schmuckes bar, im Äußern wie im Innern.
Nächst dem Dome in
Ratzeburg war es gewiß die Stadt Lübeck, welche meine Bildergalerie
im Kopfe bereicherte. Ich kannte sie so gut, da ich ja von ganz
früher Zeit bis etwa zu meinem dreißigsten Jahre fort und fort
wiederkehrte und ganze Wochen Jahr für Jahr dort verweilte. Eben
deshalb ist es aber schwer, die frühen Eindrücke, da ich noch als
Knabe oder Jüngling die Straßen durchwanderte, von den späteren zu
trennen, als ich mich bereits künstlerischen Studien näherte und
schon für meine Arbeiten iiber Kostüme zeichnete und sammelte.
Hier die
Vorlage der Transkription, in Frakturschrift, auch zum Download:

|
![]()